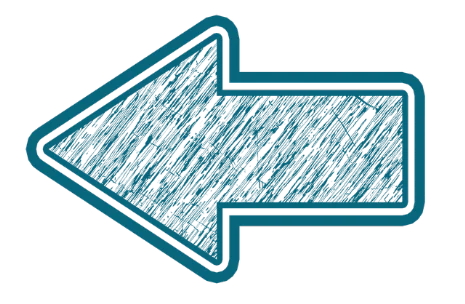Das Weihnachtsfest

Reihe: Tradition hinterfragt
Die Geschichte einer geweihten Nacht
Strenge und kalte Luft. Es wird früh dunkel. Die letzten Schnäppchen werden gejagt. Tannenbäume stehen im Angebot. Lichterketten werden angebracht.
Wer kennt dies nicht?
- Weihnachten naht.
Das besagte Fest der Liebe - Nach allem Stress, Einkauf, aller Vorbereitung – die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Familie, Freunden und Verwandten.
So soll man doch an diesen Tagen an die Geburt Jesu gedenken. Doch leider ergaben Umfragen, dass immer weniger Menschen wissen, was genau Weihnachten eigentlich bedeutet und warum man es feiert.
Mit dem Vorabend beginnend (Heilig Abend) rechnet man Weihnachten vom 24.-26.12. als gesetzliche Feiertage in vielen Staaten.
Warum gerade an diesem Datum?
Man beginnt es zu lesen und schon wird man von vielen Namen überwältigt - das Neue Testament. Es fängt mit dem Stammbaum Jesu Christi an. Nun, das Neue Testament beginnt tatsächlich mit Weihnachten. Allerdings nennt es kein festes Datum. Den Schreibern der Bibel war es nicht so wichtig, dieses anzugeben.
Anhand verschiedener Texte der „Heiligen Schrift“ können wir wenigstens herausfinden, in welchem Monat Jesus höchstwahrscheinlich geboren wurde. Lukas berichtet im ersten Kapitel über Zacharias, der gerade im Tempel arbeitete, dass ihm ein Engel erschien und ihm die Geburt seines Sohnes Johannes ankündigte. Dieser soll später das Volk auf den Messias vorbereiten. Nachdem er seine Arbeit im Tempel beendete, kehrte er nach Hause. So wurde tatsächlich seine Frau Elisabeth schwanger. Als Elisabeth im 6. Monat war, suchte der Engel Gabriel Maria auf und erklärte ihr, dass sie schwanger werden und einen Sohn auf die Welt bringen würde, den sie Jesus nennen sollte. Schon bald nach dieser Verkündigung suchte Maria ihre Verwandte Elisabeth auf. Voll Freude grüßte Elisabeth die nun auch schwangere Maria und segnete sie und ihr Kind.
Elisabeth war im 6. Monat als Maria schwanger wurde.
6 Monate + 9 Monate (Marias Schwangerschaft) ergeben 15 Monate
Zacharias gehörte zur Priesterordnung Abija [Lukas 1,5]. Abjia war die achte Priesterordnung [1.Chronik 24,10] von 24. Jede Priesterordnung also arbeitete im Jahr 2 Wochen im Tempel. Da das hebräische Jahr mit dem Monat Abib (März-April) anfängt, sollte die 8. Priesterordnung in Juni-Juli gearbeitet haben. In dieser Zeit kündigte der Engel Johannes den Täufer an. Als Zacharias nach Hause kam, wurde seine Frau schwanger, also Ende Juli oder eher Anfang August. So kündigte der Engel irgendwann im Januar Marias Schwangerschaft an. Folglich sollte Jesus dann wohl im Oktober geboren worden sein.
Wieso hat denn die Kirche damals Weihnachten nicht auf Oktober festgelegt? Offensichtlich wusste sie nicht, dass man diese anhand des Lukasevangelium berechnen kann. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, warum die Kirche die Feier von der Geburt Jesu auf den 25. Dezember festlegte.
Hier spielen heidnische Bräuche und Einflüsse eine große Rolle.
Die Römer feierten in dieser Zeit vom 17. bis zum 24. Dezember die Saturnalien, ein karnevals-ähnliches Fest. In dieser Zeit wurde nicht gearbeitet, Orgien wurden gefeiert, man vertauschte die Rollen vom Sklaven und Herren und tauschte Geschenke aus.
Im Jahr 274 n.Chr. bürgerte Kaiser Aurelian den Mithras-Kult in Rom ein und damit die Verehrung der unbesiegbaren Sonne. Deshalb begannen auch die Römer die Winter-Sonnenwende zu feiern, die ja in der Nacht zwischen dem 21. und 22. Dezember liegt.
Weiter finden wir Wurzeln bei den Teutonen und Kelten. Die beiden Völker feierten im November den Totenkult. Von Mitte Dezember bis Mitte Januar feierten sie dann auch noch die Winter-Sonnenwende mit verschiedenen Feuer-Riten. Dabei schmückten sie ihre Häuser mit Efeu und Misteln, weil diese Pflanzen für sie als Symbole des Lebens galten. Wie bei den Römern, beschenkte man sich gegenseitig und man aß Lebenskuchen, der durch seine runde Form die lebensspendende Sonne darstellte.
Kirchenväter wie Origenes und Epiphanes lehnten die Geburtstagsfeier streng ab, denn sie deklarierten solche Feier als Sünde. Da jedoch die Kirche die Feste der Römer und die der Heiden nicht abschaffen konnte, überlegte sich der römische Bischof zu dieser Zeit ein christliches Fest, welches die heidnischen Feiern verdrängen sollte. Er wählte dazu die Geburtstagsfeier Jesu und legte sie für den 25. Dezember fest. Dieser Schritt war besonders eine Kampfansage gegen die Sonnenanbeter im Mithraskult. à Nicht die Sonne bringt Licht und Leben, sondern Jesus Christus! Er ist die Sonne der Gerechtigkeit, das wahre Licht, das die Finsternis dieser Welt erleuchtet. Johannes schreibt auch im ersten Kapitel seines Evangeliums: „In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen.“ [Johannes 1,4-5]
Doch leider haben die Menschen damals nicht wirklich begriffen, was es mit der Geburtstagsfeier Jesu auf sich hatte. Man feierte einfach genauso weiter, wie es zuvor gängig war. Es war nicht wichtig was gefeiert wurde, sondern dass gefeiert wurde. Nach den vergeblichen Versuchen, die heidnischen Bräuche im Volk auszumerzen, brachte die Kirche um die Jahrtausendwende einen neuen Sinn hervor: Die Kerzen sind Symbole für Jesus, das Licht der Welt. Man beschenkt sich gegenseitig, sowie Gott uns mit seinem Sohn beschenkt hat. Zumal Geschenke auch ein Zeichen der Nächstenliebe sind. Leb(ens)kuchen sollten daran erinnern, dass Jesus das Brot ist, durch das wir leben können. Efeu und Misteln wurden zu Symbolen des Lebens.
Die erste Darstellung der Krippe, wie sie heute geläufig ist, stellte Franz von Assisi im 12. Jahrhundert auf. Die Weisen aus dem Morgenland sind dagegen fehl am Platz, denn als die Weisen Jesus antrafen, waren Joseph und Maria bereits in einem Haus in Bethlehem.
Die Bibel sagt nicht, dass es drei waren und dass sie Kaspar, Melchior und Balthasar hießen. Diese Namen bekamen sie erst im 6. Jahrhundert nach Christus.
Der Nikolaus und der Weihnachtsmann sollen beide auf den Bischoff Nikolaus von Myra zurückgehen, der im 5. Jahrhundert n. Chr. lebte. Dieser beschenkte notleidende Menschen, besonders Kinder. Und er verhalf auch Mädchen zur Heirat mit der nötigen Mitgift, die er dann heimlich vor die Tür legte. Nach seinem Tod ernannte die Kirche ihn für heilig und als schutzbarer Thron für die Kinder. So wurde er Nikolaus oder Weihnachtsmann, der zweimal im Jahr die Kinder beschenkte. In Deutschland verschmolz das Märchen vom Weihnachtsmann mit den Götterlegenden besonders mit Thor und Donar, dem Wettergott, der mit seinem Rentierschlitten über den Himmel fliegt und durch den Kamin in die Häuser der Menschen fährt. Nur wenige Menschen außerhalb unseres Kulturkreises kannten das Märchen vom Weihnachtsmann. Erst durch die Coca-Cola Werbung wurde sie weltweit bekannt.

Es ist nicht beweisbar, dass ein geschmückter Weihnachtsbaum von den heidnischen Festen abstammt. Dieser wurde nämlich zuerst in einem Protokoll der Elsässischen Stadt Turckheim 1597 erstmals erwähnt. Andere Historiker sagen, dass der Baum 1605 in Straßburg aufgestellt und geschmückt wurde. Den ersten Baum, der mit Kerzen geschmückt wurde, fand man zuerst 1611 von einer schlesischen Herzogin aufgestellt. Trotzdem blieb der Weihnachtsbaum in Deutschland unbekannt. Matthias Claudius bewunderte einen geschmückten Baum in Hamburg und nannte diesen in einem Gedicht 1796, so verbreitete sich das Aufstellen dieses Baumes in Deutschland.
1850 behängte der Glasbläser Müller in Thüringen zum ersten Mal eine Tanne mit Glaskugeln und Prinz Albert brachte zu dieser Zeit den Baum nach England. Aber erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts eroberte der Weihnachtsbaum die anderen Länder der Welt. Vom Historischen ist der geschmückte Baum nicht zur Sonnengottverehrung und zum Aschera Kult zurückzuführen, wie einige es behaupten. Denn Martin Luther kannte ihn noch nicht, geschweige denn, die frühen Christen. Natürlich haben manche Völker auch Bäume verehrt und Esoteriker suchen heute noch Kraft aus Bäumen, welche sie durch Umarmung erlangen.
Aber wenn etwas gleich aussieht, muss es nicht unbedingt dasselbe sein.
Oder verehren wir etwa die germanische Frühlingsgöttin Ostera, wenn wir zu Ostern Osterglocken in unsere Wohnung aufstellen?
Dürfen Christen trotz allem Weihnachten feiern?
Vieles rund um das Weihnachtsfest hat zwar einen heidnischen Ursprung, doch für uns heute keine heidnische oder magische Bedeutung.
Damals nutzte man die Pfeifenorgel im Venuskult zur sexuellen Stimulierung. Heute als typisches christliches Instrument geltend, wird sie zu Gottes Ehre eingesetzt.
Ein weiteres Beispiel wäre die Panflöte, die nach dem Gott „Pan“ benannt wurde. Im Israelitischen Gottesdienst war diese verboten. Man spielte dagegen Pauken, Tamburine und Zimbeln.
Flöten und Panflöten werden heute besonders gern gespielt und begeistern viele Christen. Wo hingegen Pauken und Zimbeln eher kritisch betrachtet werden.
Für die meisten Menschen hat Weihnachten keinen Bezug mehr zu heidnischen Kulten. Wenn wir z.B. Leb(ens)kuchen essen, denken wir nicht daran, dass diese Sonnenscheiben darstellten, welche auf magische Weise Lebenskraft vermitteln sollten. Wir kaufen auch Brötchen beim Bäcker mit einem Kreuzeinschnitt, ohne den Gedanken, dass diese eine Darstellung des Sonnenrads war. Wir essen sie ohne Angst zu haben, davon magisch beeinflusst zu werden. Heute glaubt und denkt man auch weniger, dass das Tragen von Eheringe heidnische Zwecke erfüllt, wie zu damaligen Zeiten gewollt.
Es ist interessant, was der Apostel Paulus in der Bibel anspricht: Den Göttern geopfertes Fleisch hat auf den Christen keinen magischen Einfluss. Hat es jedoch für den Verzehrenden einen heidnischen Bezug, sodass er immer daran denken muss und deshalb von Gewissensbissen geplagt wird, sollte er dieses Fleisch nicht essen.
Man sollte nicht aus den Augen verlieren, wie bemerkenswert die Kirche mit dem Weihnachtsfest als Kampfansage die heidnischen Feste der damaligen Zeit auslöschen wollte. Dabei wurden zwar viele heidnische Bräuche übernommen, aber auch christlich umgedeutet.
So war der Ursprung des christlichen Weihnachtsfestes antiheidnisch.
Nicht der Sonnengott bringt Leben, Licht und Hoffnung für die Welt, sondern Jesus Christus!
Wenn wir alles verwerten, was aus dem Heidentum stammt, so müssen wir konsequenterweise Geburtstage, Eheringe, Pfeifenorgeln, Flötenspiel und Kerzen ablehnen, um nur einige Beispiel aufzuzählen.
Ein dankbares Erinnern an das Kommen des Herrn Jesus Christus als Erlöser ist sicherlich nicht verkehrt. Selbst die Engel im Himmel stimmten bei der Geburt Jesu ein Lobgesang an. Wenn wir aber dieses Fest nur zu einem Konsumrausch machen, dass von christlichen Gefühlen nur umrahmt wird, sollten wir das auch anders bewerten.
Jesus Christus liegt nun mal nicht mehr in der Krippe und kommt auch nicht alle Jahre wieder, sondern er wurde einmal in dieser Nacht von Gott den Menschen geweiht, um als Erlöser für sie zu sterben.
Das Weihnachtsfest muss den Christen dazu animieren, an sein Zweites Kommen zu denken.

Wie feierst du Weihnachten?